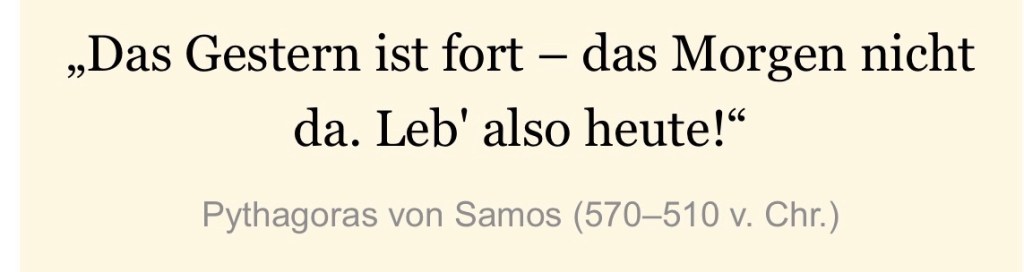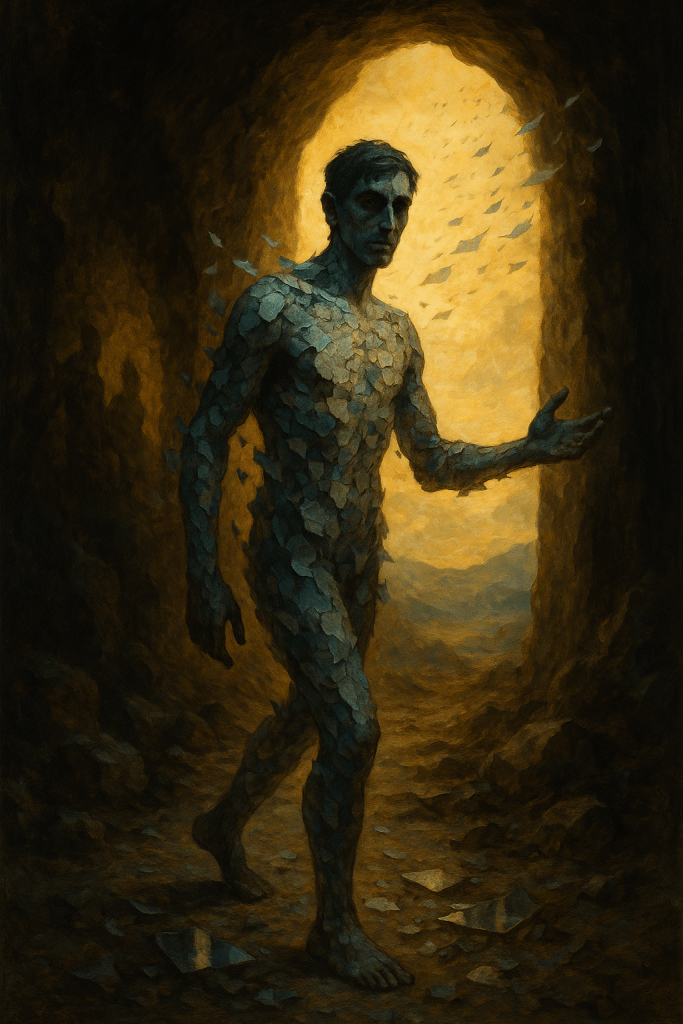In alten Zeiten beugte man sich über spiegelndes Wasser, um zu sehen, was kommen mag.
Doch wer in die Tiefe blickt, sieht nicht die Zukunft, sondern das Schweigen der Gegenwart.
Das Wasser antwortet nur, wenn man still wird – wenn der Blick nicht mehr sucht, sondern empfängt.
So war die Katoptromantie vielleicht nie eine Kunst der Vorhersage,
sondern eine Übung der Entbergung,
ein Lauschen auf das, was sich zeigt, wenn alles Tun zur Ruhe kommt.
Der Spiegel ist kein Ding.
Er ist eine Lichtung – ein Zwischenraum, in dem Sein erscheint.
Er zeigt nichts Eigenes, und gerade darin liegt sein Geheimnis:
Er verweist auf das, was ist, indem er es geschehen lässt.
In diesem Geschehen öffnet sich das Dasein selbst als Spiegel:
Das, was wir sehen, sind nicht Bilder,
sondern Rückklänge unseres eigenen Erscheinens.
Das Antlitz, das uns anblickt,
ist nicht das unsere,
sondern das Antlitz des Seins,
das uns im Blick des Spiegels entgegenkommt.
Der alte Brauch, in den Spiegel zu schauen, um zu erkennen,
ist nichts anderes als der Versuch,
die Wahrheit (aletheia) nicht zu besitzen,
sondern sie geschehen zu lassen –
wie das Licht, das auf der Wasseroberfläche spielt,
ohne Ursprung, ohne Ziel,
nur als Ereignis des Sichtbarwerdens.
Vielleicht ist der Spiegel das älteste Gesicht der Philosophie:
eine Fläche, die nichts enthält
und doch alles zeigt,
was bereit ist, sich zu offenbaren.